„Wie ich früher gemalt habe, habe ich nie Emotionen organisiert, die über den spontanen Moment hinaus gingen. Es war eben ein Einkreisen dieses Feldes. Das Aufbauen von Stimmungen innerhalb der Dimension Zeit ist eine packende Erweiterung, die irgendwie eine Parallele zum Lebensablauf hat. Das Erleben einer Geschichte, die aus dem leeren Raum zu einer Imagination wächst, ist für mich so stark, daß es meine Beobachtungsfähigkeit schärft und mir groteskerweise hilft beim Zeichnen von Bildern. Eine Geschichte erzählen ohne Befangenheit, eine Erlebnisphase darzustellen, die zurückliegt. Ich meine zum Beispiel, daß man beim Malen oder beim Fotografieren behindert wird beim Erleben. Eine naive Philosophie!“ – Rolf Borzik
Rolf Borziks Gedanke, das Malen oder Fotografieren könne das „Erleben behindern“, hallt in mir nach, als ich täglich mit Bildern arbeite. Er sprach von einer „naiven Philosophie“, die ich zunächst als kritischen Anstoß verstehe: Ja, wenn ich nur darauf fixiert bin, den Moment 1:1 festzuhalten, mag das unmittelbare Erleben in den Hintergrund treten. Doch meine eigene Praxis der Fotografie, insbesondere in meiner Rolle als Online-Redakteur, hat mich gelehrt, dass das Gegenteil der Fall sein kann: Fotografie ist für mich ein zutiefst aktiver Prozess des Erlebens und der Erkenntnisgewinnung, der meine kreative und geistige Flexibilität schult und mir hilft, die Welt auf eine tiefere, komplexere Weise zu erschließen.
Die Linse als Denkwerkzeug: Zwischen Aneignung und Erkenntnis
Susan Sontag, deren tiefgründige Analysen in On Photography meine Sichtweise maßgeblich geprägt haben, sah die Fotografie als einen Machtinstrument und Aneignungsakt. „Fotografieren heißt: sich das Fotografierte aneignen“, schrieb sie, und verstand dies als einen Akt der Verwandlung von Realität in „besitzbare Objekte“. Sie warnte davor, dass Bilder die Realität „einsperren“ und Vergänglichkeit statisch machen können. In meiner täglichen Arbeit stimme ich ihr zu, wenn es um die immense Macht des Bildes geht. Doch nutze ich diesen Aneignungsprozess bewusst als eine Methode der Wirklichkeitserschließung.
Wenn ich eine Kamera in die Hand nehme, sei es für eine Reportage oder ein Essay, geht es mir nicht darum, die Realität bloß abzubilden. Es geht vielmehr darum, meine eigene Perspektive zu finden und zu überprüfen. Die Auswahl des Bildausschnitts, die Entscheidung für ein bestimmtes Motiv, die Wahrnehmung von Farben und Details, die Formulierung einer stillen Bildbotschaft – all das sind keine technischen Handlungen, die das Erleben behindern. Im Gegenteil, sie sind der Kern meines Erlebens. Ich tauche voll und ganz in diesen Prozess ein, der mein Sehen schärft und mich zwingt, präzise zu denken: Was will ich zeigen? Welche Geschichte soll dieses einzelne Bild erzählen, wenn es später Teil einer größeren journalistischen Erzählung wird? Es ist ein Erleben des Entdeckens, des Strukturierens und des Destillierens von Bedeutung.
Jenseits des Voyeurismus: Mein dialogischer Blick im Journalismus
Sontags schärfste Kritik galt dem „voyeuristischen Blick“, der zu einer „chronisch voyeuristischen Haltung zur Welt“ führe und den Fotografen zum distanzierten Beobachter mache, der Intervention durch Aufzeichnung ersetzt. Diese Warnung nehme ich im Kontext meiner journalistischen Arbeit sehr ernst. Gerade im digitalen Journalismus, wo die Bilderflut immens ist und die Gefahr der Abstumpfung groß, versuche ich, mich von diesem Passivitäts-Vorwurf abzugrenzen.
Mein „Erleben im Fotografieren“ ist kein passiver Konsum, sondern ein aktiver, dialogischer Prozess. Wenn ich Menschen fotografiere, geht es mir nicht darum, sie auszunutzen oder bloß festzuhalten, wie sie sich selbst nie sehen würden. Vielmehr versuche ich, eine Verbindung herzustellen, sei es durch das Gespräch, die Beobachtung ihrer Umgebung oder das Verständnis ihrer Geschichte. Mein Ziel ist es, eine authentische, überzeugende Bildsprache zu finden, die sich von der oft generischen „Mainstream-Bildsprache“ in der Presse abhebt. Das bedeutet, nicht das Offensichtliche zu knipsen, sondern nach dem Besonderen, dem Ungesehenen, dem Tiefgründigen zu suchen. Es ist ein Akt der Empathie und des bewussten Hinsehens, der darauf abzielt, Resonanz zu erzeugen und nicht nur zu informieren, sondern auch zum Nachdenken anzuregen. Dieser Anspruch ist für mich unerlässlich, um nicht nur Bilder zu produzieren, sondern journalistische Inhalte zu schaffen, die überzeugen und im Gedächtnis bleiben.
Die Illusion von Authentizität und die Kunst der selektiven Wirklichkeit
Sontag warnte eindringlich vor der „geistigen Verschmutzung“ durch eine Bilderflut und betonte, dass Fotos stets „Zitate der Realität“ und niemals die Realität selbst seien. Sie sah voraus, wie „Industriegesellschaften ihre Bürger zu Image-Junkies“ machen würden – eine prophetische Vision angesichts der heutigen Social-Media-Kultur und der Allgegenwart von Deepfakes. Diese Erkenntnis ist für mich als Online-Redakteur, der ja auch für die Bildauswahl verantwortlich ist, von größter Bedeutung. Ich weiß, dass jedes Bild ein editierter Exzerpt der Wirklichkeit ist.
Meine Herangehensweise nutzt diese Fragmentierung jedoch nicht als Verfälschung, sondern als hermeneutisches Werkzeug. Ich wähle bewusst, was ich in den Bildausschnitt nehme und was ich weglasse, welche Farben ich hervorhebe oder welche Details ich in den Fokus rücke. Dies ist keine Verschleierung, sondern ein Akt der Interpretation und Lenkung der Aufmerksamkeit. Es hilft mir, komplexe Sachverhalte visuell zu zerlegen und in verständliche, wirkungsvolle Einheiten zu überführen. Es ist ein Training für meine geistige Flexibilität, die ich auch bei der Strukturierung eines Essays, der Planung einer Reportage oder der Konzeption eines Projektes benötige. Die Fotografie wird so zu einer Art visueller Denkwerkstatt, in der ich lerne, Informationen zu selektieren, Schwerpunkte zu setzen und eine kohärente Erzählung zu konstruieren.
Fotografie als ethische und kreative Grundlage meiner Arbeit
Susan Sontags Plädoyer für eine „Kultur des Hinsehens“ und Borziks augenzwinkernde Kritik an der „naiven Philosophie“ bilden für mich Reflektoren bei meiner Arbeit. Indem ich die Fotografie nicht als bloßes Mittel zum Zweck, sondern als aktiven Denkprozess begreife, entgehe ich der von ihnen kritisierten Passivität. Meine Arbeit als Online-Redakteur wird zu einer beständigen Auseinandersetzung mit der „Macht der Bilder“.
Ich nutze die Fotografie, um meine eigene Wahrnehmung zu schärfen, unkonventionelle Perspektiven zu finden und journalistische Inhalte zu schaffen, die nicht nur informieren, sondern auch bewegen und zum Nachdenken anregen. Die Kamera ist dabei nicht nur ein Werkzeug zum Festhalten, sondern ein Katalysator für Kreativität, Empathie und kritisches Denken. So wird das Fotografieren für mich zu einem integralen Bestandteil des Erlebens – nicht als Ersatz, sondern als eine tiefgreifende Erweiterung und Bereicherung meiner Interaktion mit der Welt. Es ist der Weg, wie ich versuche, überzeugende Bilder im Journalismus zu schaffen, die dem Mainstream trotzen und eine wahrhaftige, reflektierte Geschichte erzählen.

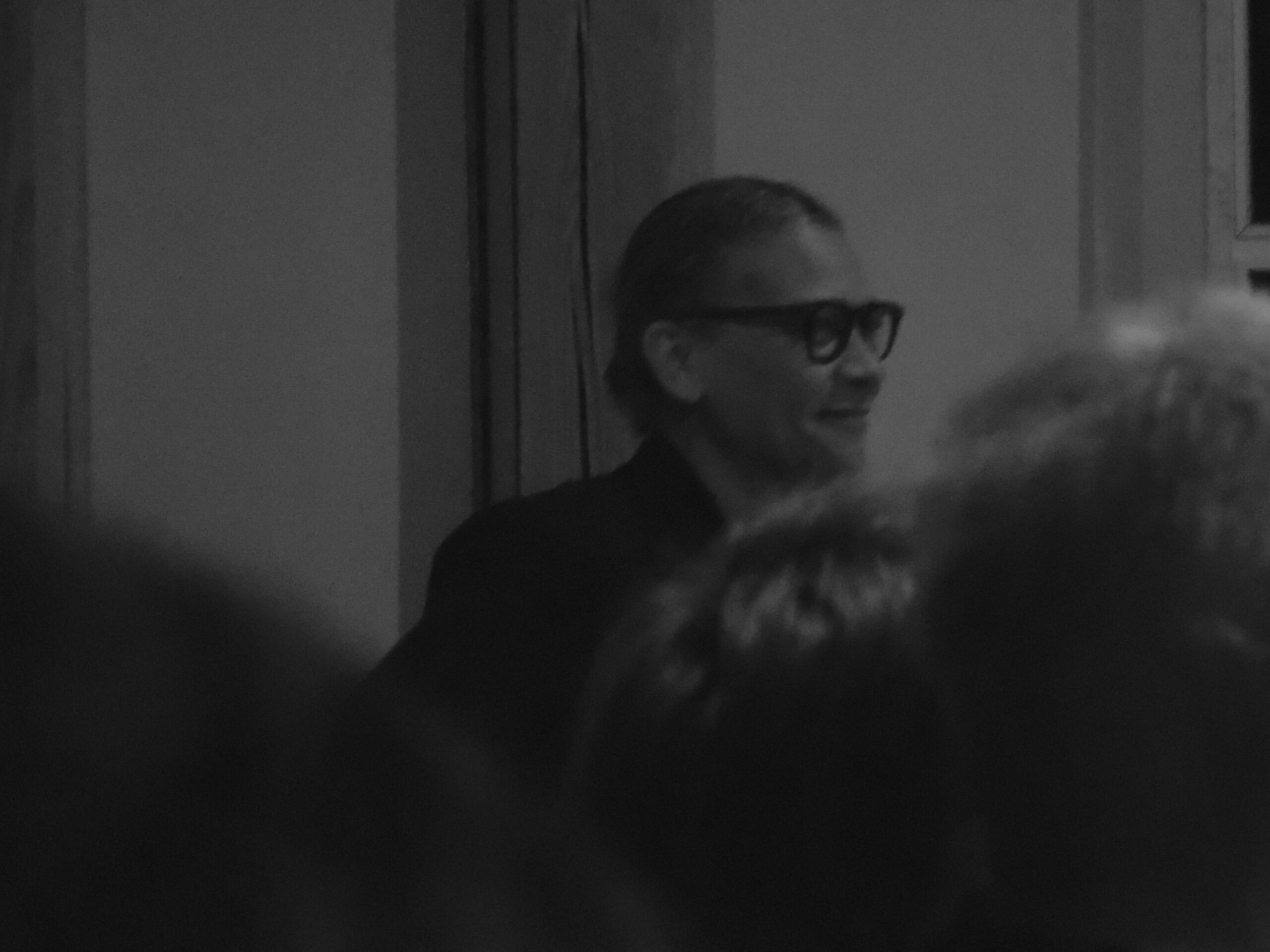
Schreibe einen Kommentar